Lasst die Moden sein!

Vi proponiamo un'intervista a Paolo Conte uscita sul settimanle Die Zeit del 27 novemebre 2008.
Anarchie ist ein Nachttier – ein Gespräch mit dem italienischen Songschreiber und Nichtsänger Paolo Conte
DIE ZEIT: »Ich spreche von meinem indianischen Schweigen«, orakeln Sie in einem Ihrer neuen Lieder, »in einem Dialekt weit entfernter Spiegel.« Können Sie sich erklären, warum weltweit so viele Menschen in Ihre Konzerte strömen, ohne eine Silbe Ihres Gesangs zu verstehen?
Paolo Conte: Ich bin gerade in Chicago vor einem überwiegend schwarzen Publikum aufgetreten, Menschen also, die weder meine Sprache noch Kultur teilen. Ihre Begeisterung kann ich mir selber kaum erklären. Aber Musik hat diesen abstrakten Charakter, dass man oft genau jene Dinge erspürt, von denen im Text die Rede ist.
ZEIT: Ist es vielleicht der Stil, der verbindet? Auch Ihr Ensemble tritt stets im Frack auf…
Conte: Tatsächlich habe ich immer den Stil des schwarzen Jazz bewundert. Da würde niemand in Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehen. Als ich in meiner Kindheit zum ersten Mal Jazz hörte, berührte mich das mehr als alles, was ich kannte. Billie Holiday, Duke Ellington, Fletcher Henderson. Ich spürte da so viel Würde. Daran glaube ich bis heute: Musik muss auch inszeniert werden. Als hohes Amt der Eleganz und Fröhlichkeit…
ZEIT: Fröhlichkeit? Man hört einen guten Schuss Bitterkeit in Ihren Songs.
Conte: Die Afroamerikaner mögen zwar jede Menge Gründe zur Trauer gehabt haben, aber klingt ihre Musik deswegen traurig? »Wir lachen, um nicht zu weinen«, hat Sam Cooke mal gesagt. Als Künstler lernst du zu lügen: Weil dein Publikum die künstlerisch verpackten Lügen mehr liebt als die nackte Realität. Du darfst dich nicht zu ernst nehmen, musst auf dem Kazoo dazwischentröten, wenn die Streicher ins allzu Feierliche abgleiten. Aber tief darunter muss doch eine Wahrheit stecken. Das habe ich am Blues immer geschätzt.
ZEIT: Allerdings kommen Sie im Gegensatz zu den meisten schwarzen Bluessängern aus einer wohlhabenden Anwaltsfamilie…
Conte: Der Blues hat für mich nichts mit Armut zu tun. Er hat mich gesucht, und ich habe ihn angenommen. Vielleicht ist da eine kollektive Traurigkeit meiner Generation, der durch den Krieg so viel Lebensfreude genommen wurde. Als ich klein war, hatte Mussolini den Jazz verbieten lassen. Doch meine Eltern scherten sich nicht drum, hörten im Wohnzimmer heimlich importierte Platten. Mein Vater, ein Freizeitpianist, spielte manche der Songs sogar auf dem Klavier – und ich saugte ihre elektrisierende Sinnlichkeit in mich auf. Später versuchte ich, es ihm gleichzutun.
ZEIT: Auch als Anwalt, denn Sie studierten trotz Ihrer Liebe zur Musik Jura und übernahmen die Kanzlei Ihres Vaters.
Conte: Jura war die Wahl meiner Familie, ich selbst hätte lieber Medizin studiert, um in die Forschung zu gehen. Doch ich habe die Musik nie ruhen lassen: Ein paar Monate lang spielte ich als Vibrafonist in der Combo eines Kreuzfahrtschiffs, 1960 habe ich mit meinem Quartett an einem Jazzwettbewerb in Norwegen teilgenommen – als Vertreter Italiens. Jazz bedeutete für mich das Gegenteil von Faschismus: viele Menschen, die gemeinsam swingen, aber jeder behält seine individuelle Stimme.
ZEIT: Ihre eigene Stimme haben Sie erst spät gefunden. Warum mussten Sie zuvor Hits für andere schreiben – Azurro für Adriano Celentano und Gelato al Limon für Lucio Dalla?
Conte: Mir hat meine Stimme nie gefallen. Sie klingt wie das Knarzen einer rostigen Tür. Deshalb habe ich erst 1974 angefangen, selbst zu singen.
ZEIT: Schreiben Sie für männliche Hörer? »Die Frauen hassten den Jazz / Man weiß nicht, worum es geht«, mokieren Sie sich in einem Ihrer Songs.
Conte: Am Anfang meiner Karriere habe ich vor allem vor Männern gesungen. Sie konnten sich in meinen Geschichten wiederfinden – und mir hat ihre Anteilnahme enorme Befriedigung verschafft. Die Frauen kamen erst später dazu, sie wollten wohl erfahren, was ihre Männer so beschäftigt.
ZEIT: Sie haben behauptet, Frauen liebten die Karosserie eines Autos, aber Männer interessierten sich eher für das Innenleben, den Motor.
Conte: Sehen Sie, die Männer waren doch immer diejenigen, die sich in der Metaphysik, der Dichtung verloren, um tiefer in die Geheimnisse der Welt einzudringen. Während die Frauen viel rationaler denken. Sie entscheiden, während wir noch grübeln.
ZEIT: Als Sänger verkörpern Sie den angeschlagenen, aber sich mit seinem Schicksal arrangierenden Mann – als Gegenmodell zum jugendlichen Rebellen. Was macht für Sie den Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen aus?
Conte: In einem Popsong würde es heißen, dass eine Frau da sein muss, um einen Jungen zum Mann zu machen. Aber das glaube ich nicht. Es liegt wohl eher an den Lebensregeln, die man lernen muss. Etwa den Mut, für andere einzutreten. Ein Opfer zu bringen. Etwas Größeres kann man nicht leisten. Das heißt nicht, dass ich mich als Vorbild empfinde. In meinem Leben hatte ich sehr wenig Gelegenheit, diese Sorte Mut zu beweisen. Eher kann ich mich mit meinem guten Geschmack brüsten. Ich würde nie zu McDonald’s essen gehen.
ZEIT: Oder triviale Sonnenuntergänge pinseln. Wie Ihre Musik scheinen auch Ihre Bilder von einem gediegen-historisierenden Eklektizismus geprägt. Was hat Sie veranlasst, zunehmend als Maler in Erscheinung zu treten?
Conte: Bestimmt nicht, dass ich nicht genug Platten verkaufe und das Zubrot brauche. Aber die Malerei bleibt meine erste Liebe. Ich habe schon den Pinsel geschwungen, bevor ich meinen ersten Song komponiert habe. Es kostet mich einfach weniger Überwindung, vor einer Staffelei zu stehen als diese Brummel-Stimme auf die Bühne zu tragen. Doch dann hat sich mein Handicap als Gewinn herausgestellt: Weil ich mit dem Gesang mehr ausdrücken kann als mit jedem Bild.
ZEIT: Sie sind oft mit Bob Dylan, diesem anderen großen Nicht-Sänger und Poeten, verglichen worden.
Conte: Wo sehen Sie denn da Gemeinsamkeiten? Eher fühle ich mich mit Tom Waits oder Randy Newman verwandt. Letzterer ist einer der wenigen Menschen im Popzirkus, dessen Musik mir einfach nie auf die Nerven geht. Ich glaube, das liegt daran, dass Newman keine Moden mitmacht. Er geht immer nur der eigenen Nase nach. Ein altmodischer Trotzkopf. Das macht mich so glücklich, genau wie alte Schellacks zu hören.
ZEIT: Dabei hat auch Dylan vor Kurzem behauptet, er beschäftige sich fast nur noch mit Musik aus den zwanziger und dreißiger Jahren.
Conte: Nun, wenn das so ist: Möglicherweise haben wir doch gemeinsame Inspirationsquellen. Ich fühle mich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg jedenfalls auf wunderbare Weise zu Hause. In der Malerei wie in der Musik. Die Moderne mit all ihrem Fortschrittsoptimismus hat da einen ersten Knacks erhalten, und aus diesem Spalt kommen die wunderbarsten Dinge gekrochen.
ZEIT: Leben Sie in der Vergangenheit?
Conte: Es gab Zeiten, da habe ich tatsächlich zurückgeblickt, eine Sehnsucht nach dem Unwiederbringlichen empfunden, die sich wohl auch in meinen Songs äußerte. Aber will ich deswegen wirklich in der Vergangenheit leben? Nein, viel besser ist es doch, etwas von ihr in unsere Gegenwart zu holen. Die metaphysische Lust der Malerei, immer neue Grenzen überschreiten zu wollen. Die zärtliche Genauigkeit, mit der Duke Ellington jede seiner Noten setzte. Oder die Bühnenrituale seiner Big Band.
ZEIT: Sie schreiben nicht nur ausgefeilte Partituren für eine orchestrale Besatzung von Vibrafon bis Harfe, sondern gehen auch äußerst sorgfältig mit Worten um. Stört Sie die Geschwätzigkeit des Pop?
Conte: Mir ist egal, was andere tun. Aber diese altmodische und überlegte Sprechweise könnte für junge Menschen heute wieder nützlich werden. In mir lebt da ein kleiner Anarchist: keine Moden mitzumachen und langsamer vorzugehen, als es etwa die Plattenfirma erwartet. Es hängt aber auch viel am Mentalitätsunterschied zwischen der englischen und der italienischen Sprache. Leider habe ich nie Englisch gelernt. Diese Sprache hat eine Musikalität, die sich viel leichter in einen Song einfügt. Wie wunderbar etwa die surrealen Metaphern bei Bessie Smith mit dem Blues harmonieren, ohne dabei aufzutragen. Italienisch dagegen ist so sperrig. Man muss immer aufpassen, dass nicht nur vertonte Gedichte rauskommen. Deswegen muss ich zum Komponieren von Text und Musik stets am Piano sitzen.
ZEIT: Sie komponieren viel in der Nacht?
Conte: Die Schwingungen der Welt verändern sich zur Nachtzeit. Das Gehirn denkt anders. Und es ist ruhig. Vielleicht halten deshalb viele Menschen meine Lieder für melancholisch. Dabei sollen sie doch eher das Glück besingen.
ZEIT: Steckt dahinter nicht auch eine Trauer über die unperfekte Welt?
Conte: In der Nachkriegszeit hat die Melancholie meiner Generation das Leben gerettet; sie hat uns erlaubt, trotz aller Verluste zu genießen. Den meisten fehlt heute angesichts der Alltagshektik die Zeit für sinnliche Erfahrungen. Deshalb verbringe ich jede Minute, die ich nicht auf Tournee bin, in unserem Landhaus mit meiner Frau, lese moderne griechische Dichter, male zur Entspannung. Und meide Gesellschaft. Warum sollte ich die Mitmenschen auch mit unfertigen Gedanken belästigen? Dazu bin ich viel zu selbstkritisch.
ZEIT: Sie sind ein ganz schöner Perfektionist. Was wird einmal auf Ihrem Grabstein stehen?
Conte: Er war der beste Kazoo-Spieler der Welt!
Das Gespräch führte Jonathan Fischer
Tratto da Die Zeit, 27.11.2008

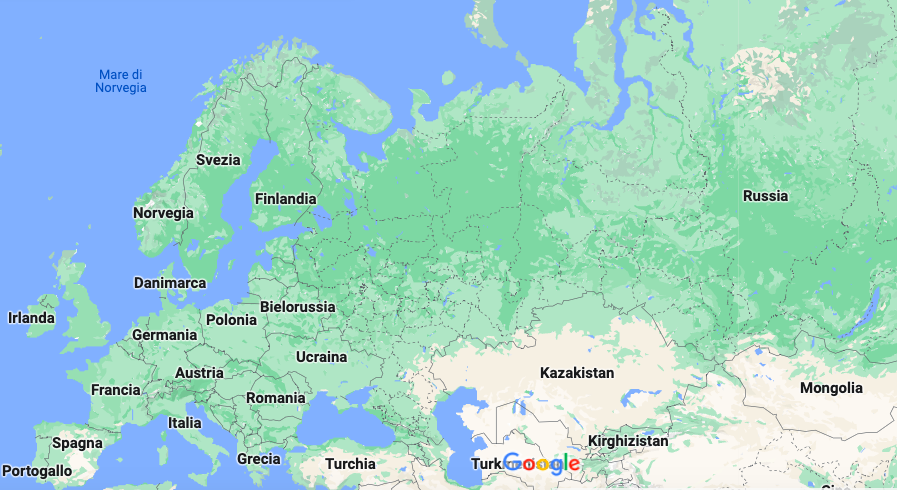

Commenti
Posta un commento