Jo Nesbø über ... Karriere

Vi propongo una interessante intervista di Martin Wittmann allo scrittore norvegese Jo Nesbø, uscita nell'inserto Wochenende della Süddeutsche Zeitung del 7 gennaio scorso.
Jo Nesbø über ... Karriere
Jo Nesbø wurde 1960 in Oslo geboren. Früh wurde sein fußballerisches Talent erkannt, doch eine schwere Verletzung machte seinen Traum von einer Karriere bei den Tottenham Hotspurs zunichte. Danach reüssierte er erst als Finanzanalyst, dann als Frontmann der damals beliebtesten Band Norwegens, Di derre. Das Manuskript seines ersten, während einer Auszeit in Australien geschriebenen Krimis (“Der Fledermausmann“) gab er unter falschem Namen ab, um nicht als schreibender Rockstar abgestempelt zu werden. Acht weitere vielfach ausgezeichnete Krimis mit dem alkoholkranken und beziehungsunfähigen Polizisten Harry Hole folgten. Darunter waren „Rotkehlchen“, der zum besten norwegischen Krimi aller Zeiten gewählt wurde, und „Schneemann“, der demnächst in Hollywood von Martin Scorsese verfilmt wird. Daneben hat Nesbø drei erfolgreiche Kinderbücher und den Roman „Headhunter“ geschrieben, dessen hochgelobte Verfilmung am 15. März in die deutschen Kinos kommt. Nesbø hat eine Tochter.
Jo Nesbø sitzt drahtig, mit blondem Vollbart als skandinavisches Klischee vor einem englischen Frühstück. Der leicht verkaterte Bestsellerautor hat viel zu erzählen an diesem sonnigen Morgen im Restaurant des Hamburger Sofitel - so viel, dass er nach der vereinbarten Stunde seinen Gesprächspartner im Taxi mitnimmt zum Bahnhof, von dem aus seine Lesereise weitergeht.
SZ: Herr Nesbø, in wie viele Sprachen ist Ihre Krimireihe um den Ermittler Harry Hole übersetzt?
Jo Nesbø: Soweit ich weiß, in mehr als 40.
SZ: Die ganze Welt kennt Sie als Schriftsteller. Schaut man sich aber Ihre Biographie an, wird einem ganz schwindelig vor lauter anderen Karrieren.
JN: Sie meinen als Fußballspieler? Das hat ja leider nicht geklappt.
SZ: Obwohl Sie schon mit 17 Jahren in der höchsten norwegischen Liga spielten.
JN: Ich habe damals gedacht, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein britischer Scout mich sehen und mir einen Vertrag für die englische Profiliga unterbreiten würde. Doch eines Tages, bei einem Spiel, wurde ich von links umgegrätscht. Ich spielte weiter. Kurze Zeit später wurde ich dann von rechts umgegrätscht. Ich erinnere mich noch genau daran, was der Arzt sagte, als er sich später die Röntgenaufnahmen angesehen hatte: Ihre Knie sehen aus wie Kriegsgebiete. Zwei Kreuzbandrisse. Das war's mit Fußball.
SZ: Plan B?
JN: Hatte ich nicht. Damals war ich mir sicher, das Leben käme auf mich zu, und ich müsste nichts dafür tun. Ich blickte auf harte Arbeit herab; das war etwas für Loser.
SZ: Und plötzlich waren Sie der Loser, mit Ihren Kriegsgebieten an den Beinen.
JN: Meine Noten waren zu schlecht, um an den guten Unis zu studieren. Also meldete ich mich freiwillig für zwei Jahre zum Militärdienst. Im zweiten Jahr ließ ich mich in den Norden Norwegens versetzen, in einen wirklich verlassenen Ort. Dort verbrachte ich ein Jahr, in der Dunkelheit nahe dem Nordpol.
SZ: Was wollten Sie da oben?
JN: Ich habe so drei Schuljahre in neun Monaten nachgeholt. Danach konnte ich studieren, wo ich wollte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas auf eigene Initiative hin tat.
SZ: Ihre Erkenntnis?
JN: Dass man sich das, was man will, holen muss. Wohl die einschneidendste Erfahrung meines Lebens.
SZ: Nach einem Wirtschaftsstudium wurden Sie Finanzanalyst. Wie bitte passt Ihr Job als Aktienhändler zwischen die Stationen Fußballprofi und Schriftsteller?
JN: Ich bin schon ein Nerd, der sich für Aktienoptionen und Future Indizes begeistern kann. Aber vor allem wollte ich einen Job, der mir erlaubt, nach Feierabend meinem Hobby nachzugehen.
SZ: ,Hobby' ist gut; Sie waren Gitarrist und Sänger der damals erfolgreichsten Band Norwegens. Wie kam es?
JN: Es begann als ganz nettes Projekt, mit meinem Bruder und ein paar Freunden, wir probten vielleicht einmal die Woche. Obwohl wir sehr schlecht waren, spielten wir ab und zu in dem Club, in dem unser Bassspieler arbeitete. Wir mussten uns etwas überlegen, damit die Besucher unserer Konzerte wiederkamen. Also änderten wir jede Woche unseren Namen.
SZ: Es kamen also keine Fans, sondern immer nur Neugierige, die dann doch immer der gleichen Band zuhören mussten?
JN: Ja, irgendwann fragten die Leute nur noch, ob ,die da' wieder spielten, auf Norwegisch: ,Di derre'. So nannten wir uns dann schließlich auch. Wir bekamen einen Plattenvertrag, spielten aber weiterhin nur am Wochenende. Auf unserem zweiten Album waren dann zwei Hits. Von da an änderte sich alles. Wir spielten 180 Konzerte in einem Jahr. Ich war der Frontmann und gleichzeitig der Einzige, der seinen geregelten Job behalten hatte.
SZ: Warum haben Sie nicht einfach das Leben als Rockstar genossen, wie es jeder normale Menschtun würde?
JN: Ich wollte nicht kündigen und plötzlich die Musik als meine Arbeit ansehen müssen. Ich wollte, dass die Musik meine Leidenschaft bleibt, nicht etwas, womit ich meine Miete verdiene. Anfangs mochte ich diese Balance, als Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu leben.
SZ: Wie sah Ihr Alltag damals aus?
Ich saß tagsüber im Büro und folgte den Indizes. Um vier schlossen die Märkte, dann packte ich meine Sachen, raste mit dem Taxi zum Flughafen, flog zum Auftrittsort, traf die Band und spielte das Konzert. Danach haben die anderen mit wunderschönen Frauen gefeiert. Ich aber bin ins Hotel, um am nächsten Morgen die erste Maschine nach Oslo zu nehmen und dort wieder im Büro zu sitzen.
SZ: Wie lange ging das gut?
JN: Nach einem Jahr kam der Burn-out.
SZ: Sie setzten sich ins Flugzeug nach Australien und schrieben dort Ihren ersten Harry-Hole-Krimi. Ihre nächste Karriere.
Dabei wollte ich nie Schriftsteller werden. Ich wollte Bücher schreiben.
SZ: Mit Verlaub: Was ist der Unterschied?
Es geht darum, was einen antreibt; will man etwas sein oder will man etwas schaffen? Der Test geht so: Würde ich auch Bücher schreiben, wenn mein Name nicht auf dem Cover steht, wenn ich als Unbekannter sterben würde?
SZ: Wie ein Schreiner, dessen Name ja auch nicht auf jedem Stuhl steht.
JN: Genau. Ich habe mir diese Fragen gestellt und bin überraschenderweise zu dem Entschluss gekommen, dass es mir tatsächlich vor allem um das Produkt geht.
SZ: Ihre Produkte sind preisgekrönt und verkaufen sich fabelhaft. In Großbritannien etwa soll alle 23 Sekunden ein Buch von Ihnen über den Ladentisch gehen. Scheint so, als hätten Sie seit Ihrer Verletzung nie wieder so etwas wie Enttäuschung erlebt, oder?
JN: Ich mag dieses Image, ich werde es jetzt nicht zerstören.
SZ: Seien Sie einfach ehrlich.
Nun gut. Natürlich habe ich Enttäuschungen erlebt. Private, aber auch berufliche, die im Vergleich zu denen anderer Menschen mickrig sind. Ich habe zum Beispiel einmal zwei Jahre lang an einem Roman gesessen, bis ich gemerkt habe, dass er einfach nicht gut genug war. Nach zwei Jahren habe ich die ,Entfernen'-Taste gedrückt und sofort angefangen, ein anderes Buch zu schreiben. Zwei Jahre zum Fenster rausgeschmissen.
SZ: Sie haben alles gelöscht?
JN: Ja, aber nicht das Drücken der Taste war die Enttäuschung, sondern die vorhergegangene Einsicht, dass ich nicht die Fähigkeit hatte, das zu schreiben, was ich schreiben wollte. Die Taste zu drücken, war eine Befreiung. Endlich weg. So als ob man mit einem Mädchen Schluss macht und dabei merkt, dass man das schon viel früher hätte machen müssen.
SZ: Sie haben auch ein Buch geschrieben, in dem Sie Ihre Erfahrungen als Aktienhändler einbringen. Der Protagonist von ,Headhunter' ist eine mitleiderregende Wurst mit Komplexen. Warum so böse?
JN: Man hat diese stereotype Vorstellung von Spekulanten aus Filmen wie ,Wall Street'. Die Wahrheit ist: Vieles davon stimmt. Der Grundgedanke ist Gier. Nicht unbedingt immer nach Geld, sondern auch nach Anerkennung, nach der großen Liebe. Der typische Stock Broker war als Jugendlicher schon ein Unternehmertyp, und sicher keiner, der Fußball oder Gitarre spielen konnte.
SZ: Einer, der nie Mädchen abkriegte?
JN: Vielleicht mal eines, weil er der war, der die Partys zu organisieren wusste. Aber er war sicher nicht die erste Wahl.
SZ: Entgegen Ihrer jahrelangen Weigerung, Ihre JN: Bücher verfilmen zu lassen, haben Sie die Rechte an ,Headhunter' verkauft.
Und der Film ist ziemlich gut geworden.
SZ: Er ist in Norwegen, wen wundert es noch, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Warum haben Sie Ihren Film-Boykott aufgegeben?
JN: Alle Erträge aus dem Buch gingen an meine Stiftung für die Bekämpfung von Analphabetismus. Als ich nun das Angebot bekam, die Filmrechte zu verkaufen, musste ich mir überlegen: Will ich ein Künstler sein, der mit seiner Integrität hadert, oder denke ich an den Haufen Kohle, der an die Stiftung geht? In Amerika wird das Buch jetzt noch mal verfilmt.
SZ: Genau wie der ,Schneemann', Ihr erfolgreichster Krimi mit Harry Hole, den Sie eigentlich noch lange nicht auf der Leinwand sehen wollten.
JN: Stimmt. Aber irgendwann riefen Typen von einem Filmstudio an, die zwar von meinem generellen Nein wussten, aber auch gehört hatten, dass ich die Coen-Brüder gut finde. Sie sagten also: ,Hallo, wir haben „Fargo“ gemacht.' Ich sagte dennoch ab. Die ließen aber nicht locker und baten mich, Bedingungen meiner Wahl zu stellen. Ich willigte schließlich ein und schickte ihnen eine kurze, eine sehr kurze Liste von Regisseuren, denen ich die Rechte eventuell abtreten würde.
SZ: Wer stand denn so auf dieser Liste?
JN: Das sage ich nicht. Als die Leute vom Studio die Liste sahen, meinten sie, so laufe das nicht in Hollywood. Sie könnten nicht zu einem dieser großen Regisseure gehen und sagen: ,Selbst wenn Sie das Buch gut finden und verfilmen möchten, müssen wir erst diesen Typen in Norwegen um Erlaubnis bitten.' Ich sagte, dass ich das absolut verstünde. Ein Jahr verging, bis der nächste Anruf kam.
SZ: Und, wer macht es nun?
JN: Martin Scorsese.
SZ: Sauber. Den Hype um skandinavische Krimis haben Sie wohl Stieg Larsson zu verdanken. Wie fühlt sich das an, auf den eigenen Büchern einen ,The Next Stieg Larsson' -Aufkleber zu sehen?
JN: Natürlich wäre mir lieber, gar keinen Aufkleber auf meinen Büchern zu haben. Aber es könnte ja auch schlimmer sein. ,The Next Dan Brown' zum Beispiel.
SZ: Eines haben Sie mit Brown allerdings tatsächlich gemein - Ihrer beider Schauplätze sind auf der ganzen Welt verteilt.
JN: Ich bin schon immer gerne gereist, am liebsten alleine. Mir macht es nichts aus, drei Tage lang mit niemandem zu reden. Man ist seiner Umgebung dann viel stärker ausgesetzt, kann sie besser beobachten. Ich fliege aber für gewöhnlich nicht mit dem Ziel irgendwohin, um dort Inspiration zu finden. Wenn sich später beim Schreiben eine Erfahrung einschleicht - umso besser. Ich bin einfach neugierig. Oder um es mit Peter Sellers in ,Willkommen Mr. Chance' zu sagen: ,I like to watch.
SZ: 'Harry Hole flieht um die ganze Welt, aber seinem größten Feind, dem Alkohol, entkommt er nirgends. Woher wissen Sie um die ganzen Begleiterscheinungen der Abhängigkeit?
JN: Ich bin skrupellos, wenn ich mit Leuten spreche. Auch, wenn sie Alkoholiker sind. Wenn man Menschen ernst nimmt, wenn man sich ehrlich für sie interessiert, kann man sie fast alles fragen, und sie werden antworten. Ein Beispiel: Egal wo ich hinkomme, frage ich als Erstes die Taxifahrer aus.
SZ: Über was?
JN: Über die Stadt, über das Land, über ihr Leben. Ich frage Immigranten, wiesosie ihre Heimat verlassen haben, ichfrage sie nach ihrer Familie und wie es ihnen hier ergeht. Sie sind glücklich,endlich auf andere Fragen als ,Wie lange dauert es denn noch, bis wir am Flughafen sind?' antworten zu dürfen.60 Prozent meiner Charaktere in den ersten Büchern basieren auf Taxifahrern.
SZ: Ihre Neugier ließ Sie auf Reisen auch Schreckliches beobachten. Den Sextourismus in Thailand etwa oder Kriegstraumatisierte im ehemaligen Jugoslawien. Schreiben Sie deswegen Kinderbücher, zur Entspannung?
JN: Wenn ich abends nach einem Tag des Kinderbuchschreibens zu Bett gehe, fühle ich mich auf jeden Fall besser als nach einem Tag mit Harry Hole. Einen Krimi mit vielen Charakteren und Zeitebenen zu schreiben, ist wie ein Symphonieorchester zu dirigieren. Ein Kinderbuch zu schreiben, fühlt sich hingegen an, als würde man mit einer Gitarre in einem Club auf die Bühne steigen und mit einer kleinen Band improvisieren.
SZ: Ich dachte eher, Sie richteten Ihre Arbeitsweise an der Leserschaft aus.
JN: Ich schreibe die Bücher für zwei Freunde und mich selbst. Die beiden sind mein Publikum. Sie sagen dann: Das war ganz okay. Oder: wenigstens besser als das letzte. Wie andere Leser das Buch finden, interessiert mich nicht.
SZ: Das kann ja jeder sagen. Sie müssen sich doch zumindest auf die jungen Leser einlassen.
JN: Nein, ich überlege mir eben nicht: Kapieren das die Kinder überhaupt? Soll ich es einfacher schreiben? Ich versuche eher so zu schreiben, wie ich mit ihnen spreche. Ich mache etwa Witze, die sie nicht alle verstehen. Aber sie verstehen, dass es witzig sein soll. Sie lachen ohne zu wissen, warum. Kinder erleben einen Alltag, in dem es normal ist, nicht alles zu verstehen. Sie lernen, sich durch diese Welt zu navigieren. So versuche ich an die Sache ranzugehen: Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Wenn die Kinder sie gut finden - toll. Wenn nicht: Fuck you.
SZ: Ihre krimischreibenden Kollegen . . . . . .
JN: Entschuldigung, habe ich gerade Fuck you gesagt? Das hat sich in diesem Zusammenhang nicht so gut angehört.
SZ: Ihre krimischreibenden Kollegen und Sie sind durch die Attentate in Oslo und auf Utøya im vergangenen Sommer in die Rolle von Propheten gedrängt worden. Wie haben Sie die Taten erlebt?
JN: Ich hing zu dem Zeitpunkt in einer Kletterhalle an der Wand. Erst später sah ich im Fernsehen die Bilder, es war wie im Film. Der Nachrichtensprecher unterbrach die Berichterstattung über den Anschlag und hielt seinen Finger an den Knopf in seinem Ohr. Dann sagte er, es gebe Meldungen über eine Schießerei auf Utøya. Vielleicht ist es der Krimiautor in mir, der sofort dachte: Es ist eine Insel. Es ist eine verdammte Insel. Es gibt kein Entkommen für diese jungen Menschen.
SZ: Werden Sie je über Anders Behring Breivik, den Täter, schreiben?
JN: Ich denke nicht. Was er getan hat, ist schlimmer als alles, was ich schreiben könnte. Und als Kriminalfall ist ein völlig unauffälliger Mann, der aus dem Nichts seine Frau umbringt, ohnehin viel interessanter als dieser kranke Typ auf Steroiden.

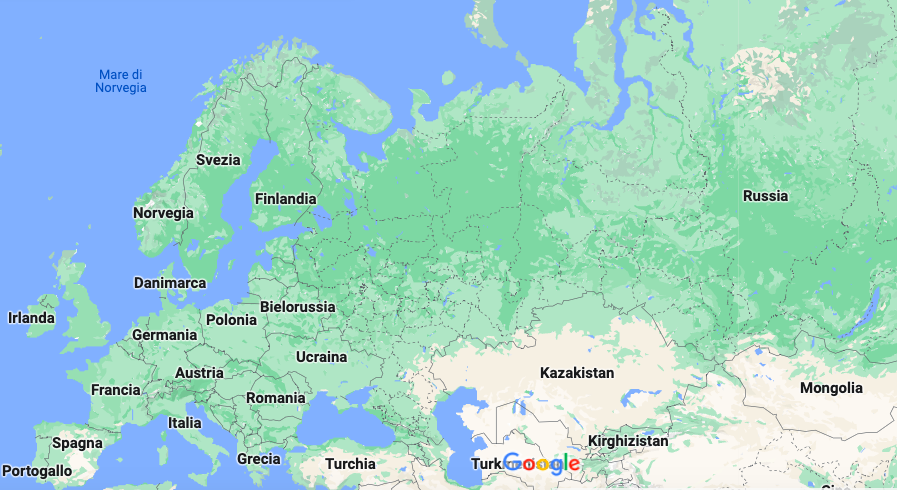

Commenti
Posta un commento