Ci si può fidare dei tedeschi?
La storia inizia il 9 novembre 1989: il giorno della caduta del Muro
di Berlino. Per la Germania è una nuova fase. La sopravvivenza della DDR (Deutsche
Demokratische Republik) era un’incognita. Nei mesi successivi a
quell’autunno di fine anni ottanta, in Germania si risveglia uno spirito
unitario fino ad allora tenuto quasi nascosto. Willy Brandt afferma:
“Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört”. Helmut Kohl, l’allora Cancelliere tedesco, capisce
che è la svolta della sua storia politica. Può essere l’uomo della
riunificazione tedesca.
Da quel momento la partita di Kohl è di convincere l’Europa che la
Germania unita è un vantaggio per tutti. È nota la contrarietà dei
principali leader politici europei: Mitterrand, Andreotti, Thatcher.
Tutti sembrano aver paura di una Germania unita. Andreotti arriverà a
dire, ironicamente: "Amo così tanto la Germania che preferisco ne
esistano due". Alla fine Helmut Kohl ottiene l’appoggio europeo, in
cambio di un impegno della stessa Germania per la costituzione
dell’Unione Europea e, soprattutto, dell’Euro. Lucio Caracciolo ha descritto molto bene quella fase politica: “Senza
la paura della Germania, non avremmo oggi l’Unione Europea. Ma senza
davvero superare la paura della Germania, non potremmo mai spingere
l’Europa oltre le secche nelle quali si è arenata dopo Maastricht.
L’Europa dell’euro è infatti frutto estremo e limite invalicabile di
un’idea di integrazione basata sul contenimento della Germania.” ("Gli usi geopolitici della germanofobia: fra Europa ed euro, in: Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell’Europa, 2001)
È da qui che bisogna partire per qualunque analisi sull’Europa e la
Germania di oggi. Per citare ancora Caracciolo, “l’euro è il pegno che
la Germania paga alla Francia in cambio dell’avallo di Parigi e del
resto d’Europa alla sua riunificazione.” Lo stesso concetto è stato
ripetuto, recentemente, dall’ex Cancelliere socialdemocratico Gerhardt
Schröder in un’intervista alla Welt am Sonntag, il domenicale
del giornale Die Welt, il mondo del 4 dicembre. Oggi, dunque, a distanza
di oltre vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, la Germania sembra
mostrare il conto al resto d’Europa. L’obiettivo della Repubblica
Federale è di fare un’Europa più tedesca.
Numerosi commentatori hanno fatto paragoni forti ed impegnativi. C’è
chi, come Marcello Pera, evocando la Germania di Hitler, ha parlato,
esplicitamente, di “operazione Anschluss” (Libero, 23 novembre 2011). Sergio Romano ha descritto un’Europa prigioniera del dogma economico tedesco (Corriere della Sera, 27 novembre 2011). Guido Rossi ha ammonito Angela Merkel invitandola a non rovinare l’Europa di Kohl (Il Sole 24 ore, 27 novembre 2011). In tutti questi commenti (e se ne potrebbero citare tanti altri) c’è l’accusa
(esplicita o implicita che sia) alla Repubblica Federale Tedesca di
voler stabilire una sorta di egemonia politico-economica in Europa. Per la terza volta nell’ultimo secolo la Germania
tenti una scalata per il dominio europeo: che si arrivi addirittura ad
una terza guerra mondiale? L'ex Ministro degli Esteri tedesco Joschka Fischer, sabato scorso, sul Corriere della Sera, sottolineava come"sarebbe una tragica ironia se la Germania unita, con mezzi pacifici e le
migliori intenzioni, causasse la distruzione dell'ordine europeo una
terza volta."
Insomma: alla Germania e ai tedeschi vengono rimproverati scarsa
solidarietà, voglia di germanizzare ed egemonizzare l’Europa ed, infine,
scarsa incisività politica nella gestione della crisi. E’ proprio qui che Angela Merkel
e la Repubblica Federale Tedesca giocano la loro partita più importante
dopo la riunificazione.
Accusare, però, i tedeschi di scarso senso europeista, attaccarli evocando i
fantasmi del passato è, forse, sbagliato, ma è anche
inopportuno perché non aiuta la comunità europea a superare questa crisi
e non aiuta nemmeno noi italiani (e tutti gli altri anelli deboli
dell’Europa) a uscire bene e più forti di prima da una crisi di cui
siamo anche responsabili.
Alla luce di questo dibattito sulla posizione della Germania, propongo due articoli usciti sulla Zeit il 4 maggio del 2005 in occasione dei sessant'anni dalla fine della dittatura nazista. La domanda a cui dovevano rispondere due giornalisti tedeschi era questa: Ci si può fidare dei tedeschi?
Il primo articolo è di Christoph Amend, il secondo di Jens Jessen
CI SI PUO' FIDARE DEI TEDESCHI?
SI, la Germania è un nazione pacifica, moderata e noiosa
Das Unbehagen fängt schon mit der Frage an. Man möchte am liebsten
rufen: Ja, warum soll man uns Deutschen nicht trauen? Man meint, das
Zischen einer Peitsche zu hören, mit der wir uns auf den Rücken
schlagen. Aber dann denkt man: Darf man das sagen, ohne in eine Ecke
gestellt zu werden mit jenen entsetzlichen Verharmlosern, die uns
einreden wollen, am besten setzten wir uns mit unserer Vergangenheit
auseinander, indem wir uns möglichst wenig damit konfrontieren lassen?
Als ob es darum ginge! Es ist gut, es ist richtig, aus Anlass des 60.
Jahrestages ihres Niedergangs an die NS-Diktatur zu erinnern. Das
Erschrecken darüber ist nach jedem Artikel, jedem Fernsehfilm noch da,
und es ist aufrichtig. Was furchtbar nervt, ist die permanente
Relativierung der Verbrechen durch geradezu absurde Bezüge. Die
Erinnerung ist noch frisch daran, wie an der Schule die bevorstehende
Vereinigung beider deutschen Staaten als imperiale Gefahr beschrieben
wurde: Klassenkameraden, sogar einige Lehrer beteiligten sich an
Demonstrationen unter der Losung: »Nie wieder Deutschland!«
Vor allem ältere Deutsche sprechen bis heute davon, dass wir gefährdet blieben. Man kann das verstehen: Sie haben erfahren, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Sie sperrten ihre Gefühle weg, um nie wieder in Pathos-Nähe zu geraten. Ihre Kinder, die 68er, wiederum haben erfahren, wie schnell man einer totalitären Ideologie verfallen kann. Sie haben erlebt, wie aus ihrer Mitte heraus Terrorismus entstanden ist.
Doch wir leben heute in einem Land, das im Westen auf fast 60 Jahre Demokratie zurückblickt. Rechts- und Linksradikalismus haben bei der Mehrheit keine Chance. Der Antisemitismus ist nicht stärker als in vergleichbaren Ländern. In Deutschland ist unvorstellbar, was im ehemals faschistischen Italien Alltag ist: Die postfaschistische Partei stellt dort den Vizeministerpräsidenten, der Regierungschef nannte Mussolini einen »gutmütigen Diktator«. Hierzulande hingegen kann sich niemand offen oder verdeckt antisemitisch äußern, ohne geächtet zu werden.
Wir gelten heute auf angenehme Art als langweilig, weil man sich weder vor uns noch weil man um uns fürchten muss. Wir müssen feststellen, dass die Welt auf die boomenden Länder China oder Indien schaut oder sich mit Russland beschäftigt. Dabei hätten wir es ganz gern, wenn wir dem einflussreichsten Nachrichtenmagazin der Welt, dem Economist, mal wieder eine Titelgeschichte wert wären. (Aber nur, wenn die sich nicht mit unserer wirtschaftlichen Misere beschäftigt.)
Zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie war zum ersten Mal ein Bundeskanzler eingeladen. Spätestens an diesem Tag, schreibt Eckhard Fuhr in seinem Buch Wo wir uns finden, war der Krieg aus. Selbst Papst können wir ganz selbstverständlich werden auf unserem »langen Weg nach Westen«, von dem Heinrich August Winkler schrieb.
So merkwürdig wir uns manchmal verhalten, wenn wir gleichzeitig Wohlstand genießen und den Kapitalismus verdammen oder wenn wir die Sicherheit der Freiheit vorziehen, sind wir doch ein Land, von dem keine Gefahr ausgeht. Und eines, das immer seltener vor sich selbst wegläuft. Als Bundespräsident Horst Köhler sagte: »Ich liebe unser Land«, protestierten nicht einmal diejenigen, die so nie denken würden. Dem Mann kann man einfach keinen Nationalismus unterstellen. Er beschreibt ein verändertes Geschichtsgefühl, so wie Richard von Weizsäcker, als er 1985 vom 8. Mai als »Tag der Befreiung« sprach; ein Gefühl, das von mehr Deutschen als vor zehn oder zwanzig Jahren geteilt wird. Das hat auch biografische Gründe. Bei den heute unter 30-Jährigen fällt oft der Satz: »Als die Mauer fiel, war ich…« 1989 ist ihr prägendes politisches Erlebnis.
Die Deutschen sind wieder neugierig auf ihr Land, sie wenden sich nicht ab wie früher, als sie sich lieber als Kosmopoliten in New York oder wenigstens als Italiener im Herzen sahen. Der Schriftsteller Stephan Wackwitz sagt, die alte Bundesrepublik sei ihm oft »geisterhaft« vorgekommen mit »Landstrichen, wohin man nicht fahren konnte und von denen niemand eine Vorstellung hatte«. Das hat sich geändert. Heute erkunden viele in den Ferien ihr eigenes, ihnen oft unbekanntes Land. Manche wandern sogar, frei von Deutschtümelei. Popmusiker wie Wir sind Helden oder Juli singen auf Deutsch, weil sie so ihre Gefühle besser ausdrücken können. Sie sind die Idole einer Jugend, die sich nicht schämt, deutsch zu sein, vielleicht, weil ihr niemand fremder ist als der ewige Hausmeistertyp, der früher Blockwart hätte sein können.
Während die skeptische Generation ihre Gefühle (und die ihrer Familien) nach 1945 eingemauert hat, werden diese Mauern zunehmend eingerissen. Filmemacher, Autoren und Maler stellen sich der Geschichte ihres Landes, ihrer Familien, aber sie werfen einen anderen, freieren Blick auf sie. Sie müssen sich nicht rechtfertigen wie ihre Großeltern, sie müssen nicht abrechnen, wie ihre Eltern es taten.
Die Deutschen sind ein vernünftiges, ruhiges, langweiliges Volk geworden.
 NO, Esiste ancora una sottile e quasi impercettibile traccia dell'ideologia nazista
NO, Esiste ancora una sottile e quasi impercettibile traccia dell'ideologia nazista
Die Deutschen werden nie wieder einen nationalsozialistischen Staat haben, gewiss. Über diese Gefahr zu reden lohnt nicht. Das Nationale wird sich nicht mehr zum Nationalismus aufblasen. Es ist auch kaum vorstellbar, dass sich der Staat noch einmal zu einer totalitären Gleichschaltung der Gesellschaft bewegen lässt. Etwas anderes ist aber die Frage, wie viel von dem nationalsozialistischen Erbe in den Köpfen übrig geblieben ist, nachdem es sich aus der Sphäre des Politischen zurückgezogen hat. Dass diese Frage meistens empört abgewiesen wird, hat mit der Demokratie zu tun, die sich fortdauerndes Misstrauen in das Volk nicht leisten kann. Vor allem aber hat es mit dem überlieferten Verdacht gegen den Staat zu tun, der traditionell als der Ort gilt, wo das Übel in Erscheinung treten müsste, wenn es denn erscheint.
Dort sitzt es aber nicht. Die staatlichen Institutionen der Bundesrepublik sind vielleicht das Einzige, das wirklich und verlässlich entnazifiziert worden ist. Selbst deutsches Militär lässt sich nur mehr schlecht beargwöhnen, seit es ein feierliches Rekrutengelöbnis am Jahrestag des 20. Julis angesetzt hat. Die Demonstranten, die dagegen protestieren, beweisen nur ihre ideologische Verblendung, vielleicht auch einen unbewussten Willen zur Ablenkung von dem Ort, an dem sich das nationalsozialistische Erbe versteckt.
Es steckt im gereizten Kern der Gesellschaft. Es steckt in den Aufpassern, den Liebhabern des Verbietens und Strafens, den hysterischen Beobachtern jeder Abweichung. Es steckt im autoritären Charakter, wie ihn Erich Fromm beschrieben hat. Es steckt in dem Nachbarn, der die Kehrwoche kontrolliert, in dem Passanten, der den Falschparker anzeigt, ohne behindert worden zu sein, in der Mutter, die anderen Müttern am Spielplatz Vorhaltungen macht. Es steckt, mit einem Wort, in dem guten Bürger, der seine eifernde Intoleranz auf Befragen wahrscheinlich als zivilgesellschaftliches Engagement ausgeben würde.
Es ist nämlich nicht so, dass die 1945 heimatlos gewordene Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft vor der Unmöglichkeit ihrer neuerlichen Umsetzung resigniert hätte. Sie hat sich vielmehr aus der Politik in den privaten Terror zurückgezogen. Sie inspiziert die Treppenhäuser, sie kontrolliert die Kleidung des Büronachbarn, sie missbilligt abweichendes Konsumverhalten und straft jeden Ehrgeiz, der sein Haupt aus der Menge hebt. Nirgendwo lässt sich das besser beobachten als in den Massenmedien, die ihrer Natur nach mit opportunistischer Sensibilität auf die Volksstimmung achten müssen. Mit peinlicher Sorgfalt wird dort alles vermieden, das als elitäre Abweichung vom Mainstream interpretiert werden könnte. Denn der Mainstream ist nur der modische Tarnausdruck für das gesunde Volksempfinden, das schon in der Nazizeit als Richterinstanz über jede, vor allem aber intellektuelle Abweichung diente. Dieser kulturelle Egalitarismus hat, anders, als manche glauben, seine Wurzeln nicht im Sozialismus, der stets um die Hebung der Volksbildung bemüht war. Das Downgrading einer ganzen Hochkultur nach dem Maßstab des Unterschichtenressentiments ist vielmehr ein spezifisches Merkmal des Nationalsozialismus.
Gewiss gibt es Intoleranz, Sozialneid und verwahrloste Massenmedien auch in anderen Ländern. Aber dieser Hinweis täuscht nur darüber hinweg, dass Intoleranz in Italien nicht zu Rostocker Exzessen führt, Sozialneid in England nicht zur Abschaffung der Hochkultur aufruft und Massenmedien in Frankreich nicht dazu neigen, Intellektuelle als Nörgler vorzuführen. Übrigens hat auch die hierzulande beliebte Razzia auf die intellektuellen Pessimisten ihren Vorläufer im Nationalsozialismus und in Goebbels Kampagne gegen »das sogenannte Miesmachertum«.
Der historische Zusammenhang von Antiintellektualismus und Antisemitismus ist gut untersucht. Beide treffen sich im Hass auf alle natur- und volksferne Betätigung. Vielleicht würde es sich auch heute lohnen, um den sozialpsychologischen Ort des anhaltenden Antisemitismus zu finden, nach dem Sitz der antiintellektuellen Ressentiments fahnden. Vielleicht ließe sich so erklären, warum Antisemiten nicht nur in der Nähe von Hirschhornknöpfen, sondern auch in Vorstandsetagen auftreten, nämlich überall dort, wo sich hemdsärmelige Macher vor kritischer Dreinrede fürchten. Denn die Verehrung des Machens und Anpackens, der Darwinismus der Tat, der im Denken nur das Zögern, im Zweifeln nur die Feigheit erkennt, ist eines der dauerhaft nachwirkenden Motive aus dem Fundus nationalsozialistischer Propaganda. Das darwinistische Argument vom Recht des Stärkeren, und sei es in der Geschäftskonkurrenz des Marktes, ist überhaupt eines der zuverlässigsten Indizien auf Wiederbetätigung im Sinne des »Dritten Reiches«.
Mag jeder für sich prüfen, wie oft ihm solche Gedankenfiguren untergekommen sind, und dann entscheiden, ob den Deutschen zu trauen ist. Gewiss sind es größtenteils nur noch Spurenelemente der NS-Ideologie. Es gibt keinen Grund, die Deutschen ernsthaft zu fürchten. Aber sorglosen Gewissens unter ihnen leben kann man auch wieder nicht.
Vor allem ältere Deutsche sprechen bis heute davon, dass wir gefährdet blieben. Man kann das verstehen: Sie haben erfahren, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Sie sperrten ihre Gefühle weg, um nie wieder in Pathos-Nähe zu geraten. Ihre Kinder, die 68er, wiederum haben erfahren, wie schnell man einer totalitären Ideologie verfallen kann. Sie haben erlebt, wie aus ihrer Mitte heraus Terrorismus entstanden ist.
Doch wir leben heute in einem Land, das im Westen auf fast 60 Jahre Demokratie zurückblickt. Rechts- und Linksradikalismus haben bei der Mehrheit keine Chance. Der Antisemitismus ist nicht stärker als in vergleichbaren Ländern. In Deutschland ist unvorstellbar, was im ehemals faschistischen Italien Alltag ist: Die postfaschistische Partei stellt dort den Vizeministerpräsidenten, der Regierungschef nannte Mussolini einen »gutmütigen Diktator«. Hierzulande hingegen kann sich niemand offen oder verdeckt antisemitisch äußern, ohne geächtet zu werden.
Wir gelten heute auf angenehme Art als langweilig, weil man sich weder vor uns noch weil man um uns fürchten muss. Wir müssen feststellen, dass die Welt auf die boomenden Länder China oder Indien schaut oder sich mit Russland beschäftigt. Dabei hätten wir es ganz gern, wenn wir dem einflussreichsten Nachrichtenmagazin der Welt, dem Economist, mal wieder eine Titelgeschichte wert wären. (Aber nur, wenn die sich nicht mit unserer wirtschaftlichen Misere beschäftigt.)
Zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie war zum ersten Mal ein Bundeskanzler eingeladen. Spätestens an diesem Tag, schreibt Eckhard Fuhr in seinem Buch Wo wir uns finden, war der Krieg aus. Selbst Papst können wir ganz selbstverständlich werden auf unserem »langen Weg nach Westen«, von dem Heinrich August Winkler schrieb.
So merkwürdig wir uns manchmal verhalten, wenn wir gleichzeitig Wohlstand genießen und den Kapitalismus verdammen oder wenn wir die Sicherheit der Freiheit vorziehen, sind wir doch ein Land, von dem keine Gefahr ausgeht. Und eines, das immer seltener vor sich selbst wegläuft. Als Bundespräsident Horst Köhler sagte: »Ich liebe unser Land«, protestierten nicht einmal diejenigen, die so nie denken würden. Dem Mann kann man einfach keinen Nationalismus unterstellen. Er beschreibt ein verändertes Geschichtsgefühl, so wie Richard von Weizsäcker, als er 1985 vom 8. Mai als »Tag der Befreiung« sprach; ein Gefühl, das von mehr Deutschen als vor zehn oder zwanzig Jahren geteilt wird. Das hat auch biografische Gründe. Bei den heute unter 30-Jährigen fällt oft der Satz: »Als die Mauer fiel, war ich…« 1989 ist ihr prägendes politisches Erlebnis.
Die Deutschen sind wieder neugierig auf ihr Land, sie wenden sich nicht ab wie früher, als sie sich lieber als Kosmopoliten in New York oder wenigstens als Italiener im Herzen sahen. Der Schriftsteller Stephan Wackwitz sagt, die alte Bundesrepublik sei ihm oft »geisterhaft« vorgekommen mit »Landstrichen, wohin man nicht fahren konnte und von denen niemand eine Vorstellung hatte«. Das hat sich geändert. Heute erkunden viele in den Ferien ihr eigenes, ihnen oft unbekanntes Land. Manche wandern sogar, frei von Deutschtümelei. Popmusiker wie Wir sind Helden oder Juli singen auf Deutsch, weil sie so ihre Gefühle besser ausdrücken können. Sie sind die Idole einer Jugend, die sich nicht schämt, deutsch zu sein, vielleicht, weil ihr niemand fremder ist als der ewige Hausmeistertyp, der früher Blockwart hätte sein können.
Während die skeptische Generation ihre Gefühle (und die ihrer Familien) nach 1945 eingemauert hat, werden diese Mauern zunehmend eingerissen. Filmemacher, Autoren und Maler stellen sich der Geschichte ihres Landes, ihrer Familien, aber sie werfen einen anderen, freieren Blick auf sie. Sie müssen sich nicht rechtfertigen wie ihre Großeltern, sie müssen nicht abrechnen, wie ihre Eltern es taten.
Die Deutschen sind ein vernünftiges, ruhiges, langweiliges Volk geworden.
 NO, Esiste ancora una sottile e quasi impercettibile traccia dell'ideologia nazista
NO, Esiste ancora una sottile e quasi impercettibile traccia dell'ideologia nazistaDie Deutschen werden nie wieder einen nationalsozialistischen Staat haben, gewiss. Über diese Gefahr zu reden lohnt nicht. Das Nationale wird sich nicht mehr zum Nationalismus aufblasen. Es ist auch kaum vorstellbar, dass sich der Staat noch einmal zu einer totalitären Gleichschaltung der Gesellschaft bewegen lässt. Etwas anderes ist aber die Frage, wie viel von dem nationalsozialistischen Erbe in den Köpfen übrig geblieben ist, nachdem es sich aus der Sphäre des Politischen zurückgezogen hat. Dass diese Frage meistens empört abgewiesen wird, hat mit der Demokratie zu tun, die sich fortdauerndes Misstrauen in das Volk nicht leisten kann. Vor allem aber hat es mit dem überlieferten Verdacht gegen den Staat zu tun, der traditionell als der Ort gilt, wo das Übel in Erscheinung treten müsste, wenn es denn erscheint.
Dort sitzt es aber nicht. Die staatlichen Institutionen der Bundesrepublik sind vielleicht das Einzige, das wirklich und verlässlich entnazifiziert worden ist. Selbst deutsches Militär lässt sich nur mehr schlecht beargwöhnen, seit es ein feierliches Rekrutengelöbnis am Jahrestag des 20. Julis angesetzt hat. Die Demonstranten, die dagegen protestieren, beweisen nur ihre ideologische Verblendung, vielleicht auch einen unbewussten Willen zur Ablenkung von dem Ort, an dem sich das nationalsozialistische Erbe versteckt.
Es steckt im gereizten Kern der Gesellschaft. Es steckt in den Aufpassern, den Liebhabern des Verbietens und Strafens, den hysterischen Beobachtern jeder Abweichung. Es steckt im autoritären Charakter, wie ihn Erich Fromm beschrieben hat. Es steckt in dem Nachbarn, der die Kehrwoche kontrolliert, in dem Passanten, der den Falschparker anzeigt, ohne behindert worden zu sein, in der Mutter, die anderen Müttern am Spielplatz Vorhaltungen macht. Es steckt, mit einem Wort, in dem guten Bürger, der seine eifernde Intoleranz auf Befragen wahrscheinlich als zivilgesellschaftliches Engagement ausgeben würde.
Es ist nämlich nicht so, dass die 1945 heimatlos gewordene Sehnsucht nach der Volksgemeinschaft vor der Unmöglichkeit ihrer neuerlichen Umsetzung resigniert hätte. Sie hat sich vielmehr aus der Politik in den privaten Terror zurückgezogen. Sie inspiziert die Treppenhäuser, sie kontrolliert die Kleidung des Büronachbarn, sie missbilligt abweichendes Konsumverhalten und straft jeden Ehrgeiz, der sein Haupt aus der Menge hebt. Nirgendwo lässt sich das besser beobachten als in den Massenmedien, die ihrer Natur nach mit opportunistischer Sensibilität auf die Volksstimmung achten müssen. Mit peinlicher Sorgfalt wird dort alles vermieden, das als elitäre Abweichung vom Mainstream interpretiert werden könnte. Denn der Mainstream ist nur der modische Tarnausdruck für das gesunde Volksempfinden, das schon in der Nazizeit als Richterinstanz über jede, vor allem aber intellektuelle Abweichung diente. Dieser kulturelle Egalitarismus hat, anders, als manche glauben, seine Wurzeln nicht im Sozialismus, der stets um die Hebung der Volksbildung bemüht war. Das Downgrading einer ganzen Hochkultur nach dem Maßstab des Unterschichtenressentiments ist vielmehr ein spezifisches Merkmal des Nationalsozialismus.
Gewiss gibt es Intoleranz, Sozialneid und verwahrloste Massenmedien auch in anderen Ländern. Aber dieser Hinweis täuscht nur darüber hinweg, dass Intoleranz in Italien nicht zu Rostocker Exzessen führt, Sozialneid in England nicht zur Abschaffung der Hochkultur aufruft und Massenmedien in Frankreich nicht dazu neigen, Intellektuelle als Nörgler vorzuführen. Übrigens hat auch die hierzulande beliebte Razzia auf die intellektuellen Pessimisten ihren Vorläufer im Nationalsozialismus und in Goebbels Kampagne gegen »das sogenannte Miesmachertum«.
Der historische Zusammenhang von Antiintellektualismus und Antisemitismus ist gut untersucht. Beide treffen sich im Hass auf alle natur- und volksferne Betätigung. Vielleicht würde es sich auch heute lohnen, um den sozialpsychologischen Ort des anhaltenden Antisemitismus zu finden, nach dem Sitz der antiintellektuellen Ressentiments fahnden. Vielleicht ließe sich so erklären, warum Antisemiten nicht nur in der Nähe von Hirschhornknöpfen, sondern auch in Vorstandsetagen auftreten, nämlich überall dort, wo sich hemdsärmelige Macher vor kritischer Dreinrede fürchten. Denn die Verehrung des Machens und Anpackens, der Darwinismus der Tat, der im Denken nur das Zögern, im Zweifeln nur die Feigheit erkennt, ist eines der dauerhaft nachwirkenden Motive aus dem Fundus nationalsozialistischer Propaganda. Das darwinistische Argument vom Recht des Stärkeren, und sei es in der Geschäftskonkurrenz des Marktes, ist überhaupt eines der zuverlässigsten Indizien auf Wiederbetätigung im Sinne des »Dritten Reiches«.
Mag jeder für sich prüfen, wie oft ihm solche Gedankenfiguren untergekommen sind, und dann entscheiden, ob den Deutschen zu trauen ist. Gewiss sind es größtenteils nur noch Spurenelemente der NS-Ideologie. Es gibt keinen Grund, die Deutschen ernsthaft zu fürchten. Aber sorglosen Gewissens unter ihnen leben kann man auch wieder nicht.
A cura di Ubaldo Villani-Lubelli



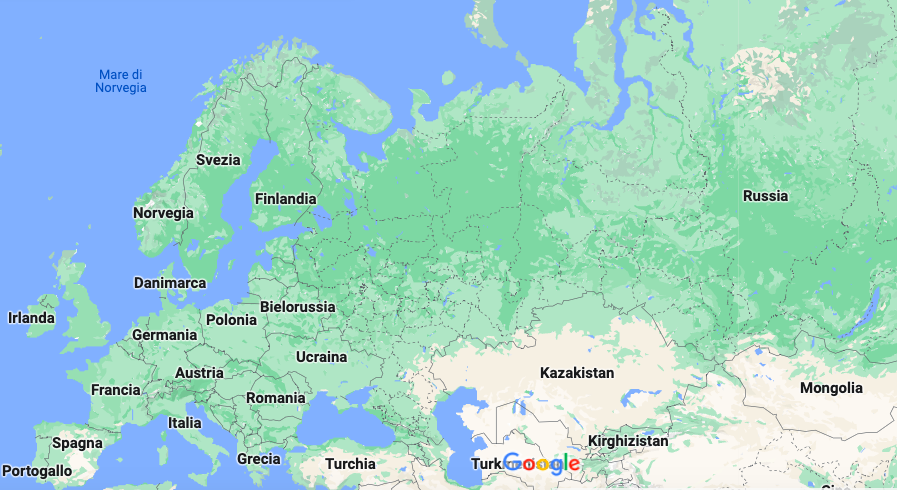

Commenti
Posta un commento